Bei Spitex Zürich arbeiten Menschen aus rund 60 Nationen zusammen – Verständigung gehört zur täglichen Teamarbeit. Im Rahmen der Aktionswoche Patientensicherheit spricht Rachel Jenkins, Pflegeexpertin APN, über Situationen, in denen Sprache eine Hürde sein kann, und über Wege zu mehr Sicherheit.
Erinnerst du dich noch an eine Begegnung, bei der die Sprache zur Barriere wurde?
Bei Spitex Zürich betreuen wir immer wieder Menschen, die nicht Deutsch sprechen. Wir pflegten eine todkranke Frau aus dem Nahen Osten in einer palliativen Situation, die allein in einer unzulänglich eingerichteten Einzimmerwohnung ohne funktionierendes Telefon lebte. Neben der Muttersprache Arabisch verfügte sie über rudimentäre Englischkenntnisse. Ich besprach mit ihr die Option der Pflege in einem Hospiz, doch sie wehrte massiv ab. Erst dank der Unterstützung einer professionellen Dolmetscherin zeigte sich der Grund: Sie hatte «hospital», also Spital statt Hospiz, verstanden. Nachdem dieser Irrtum geklärt war, konnten wir gemeinsam ein passende Pflegelösung finden.
Was bedeutet Sprachverständnis für die Sicherheit der Kundinnen und Kunden?
Sicherheit heisst mehr als «Anordnungen korrekt ausführen». Informationen müssen notwendige Kenntnisse auf einfache Art vermitteln und richtig aufgenommen und verstanden werden. Ein Beispiel: Ein fremdsprachiger Kunde erhielt vom Hausarzt ein Dosiergerät zum Inhalieren. Weil er keine Wirkung spürte, verbrauchte er am ersten Tag alle Dosen, die für eine Woche gedacht waren. Nachdem seine Tochter meine Erklärungen übersetzt hatte, war ihm die Anwendung klar. Die Überwachung von Blutdruck und Puls zeigte, dass die Überdosierung zum Glück ohne Folgen blieb.
Ebenso zentral ist es für die Sicherheit, den Gesundheitszustand korrekt zu erfassen, Symptome richtig zu beurteilen und passende Massnahmen einzuleiten. Sicherheit bedeutet auch, dass sich Kundinnen, Kunden und Angehörige mit ihren Fragen ernst genommen und gut aufgehoben fühlen. Bei Bedarf unterstützen wir sie bei der Verständigung mit den Ärztinnen und Ärzten. Das setzt gegenseitiges Verstehen voraus.
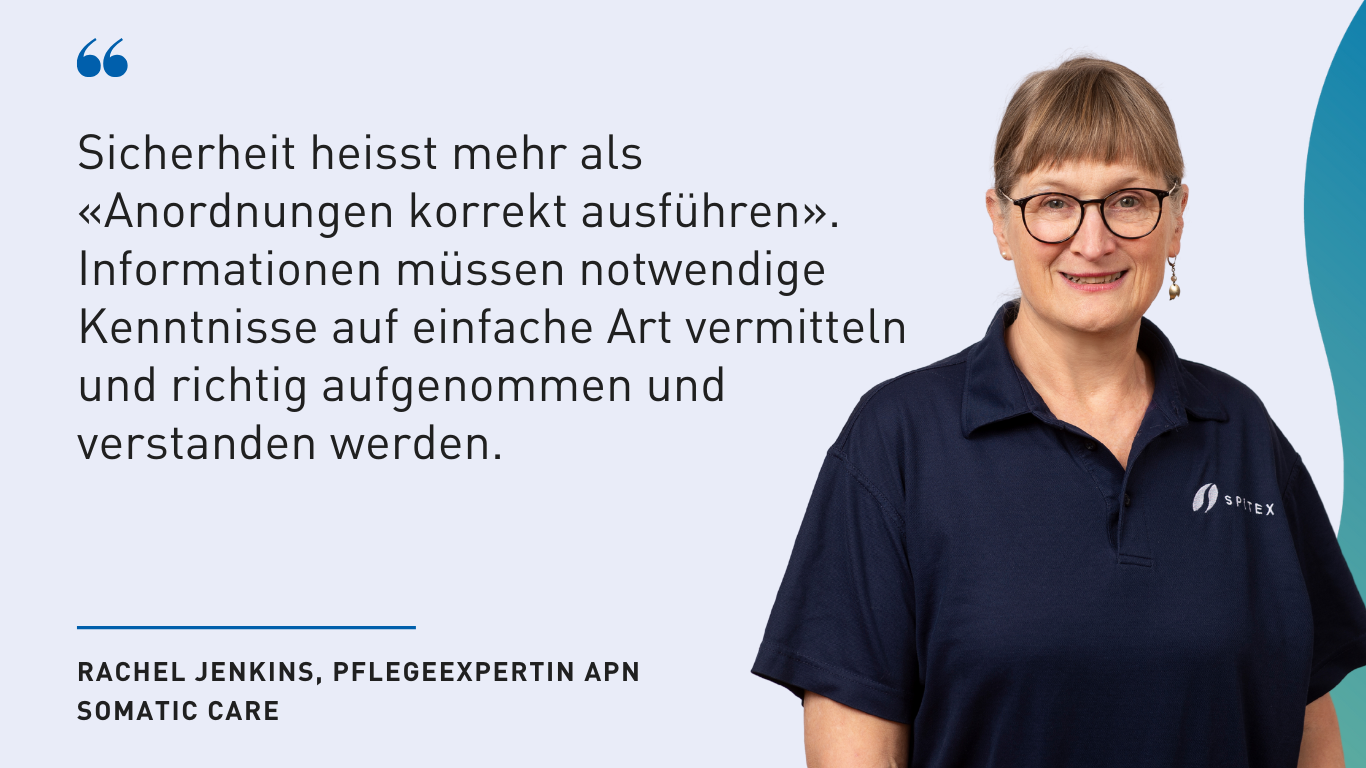
Wie geht ihr vor, wenn Kundinnen und Kunden Anweisungen nicht verstehen?
Im Alltag helfen nonverbale Mittel: beobachten, Gestik, Mimik, Anleitung durch Berührung – darin sind unsere Mitarbeitenden sehr kompetent. Sobald eine unerwartete Situation eintritt oder ein komplexer Sachverhalt erklärt werden muss, reicht das nicht mehr. Dann braucht es Übersetzungen, damit Veränderungen korrekt erfasst und Informationen wirklich verstanden werden. Wesentlich ist auch, die Stimme der Kundinnen und Kunden zu hören: Was ist wichtig, welche Vorstellungen und Bedürfnisse sind da?
Welche Massnahmen sind sinnvoll, wenn die Verständigung schwierig ist?
Häufig sind Verwandte oder Bezugspersonen erreichbar, die beim Übersetzen helfen können – manchmal auch in einem Telefonat zu dritt. Unmündigen Kindern sollte diese Aufgabe nicht zugemutet werden. Und auch innerhalb von Familien gibt es Grenzen: Eine Kundin mit schwerer Inkontinenz lebte mit ihrem Sohn zusammen – bei diesem sensiblen Thema konnten wir ihn aus Rücksicht auf ihre Intimsphäre nicht als Übersetzer einbeziehen.
Intern lohnt sich der Blick ins eigene Netzwerk. Bei Spitex Zürich gibt es viele Mitarbeitende mit unterschiedlichen Muttersprachen. Sie können punktuell unterstützen, organisatorisch ist das jedoch anspruchsvoll. Hilfsmittel wie Sprach- oder Bildtafeln, digitale Hilfsassistenten oder weitere Übersetzungshilfen (z. B. vom Roten Kreuz) helfen ebenfalls. Bei weitreichenden Entscheidungen – wie etwa einer Patientenverfügung – ist der Einsatz professioneller interkultureller Dolmetschenden unerlässlich.
Wann ist es sinnvoll, eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher beizuziehen?
Wir haben klare Kriterien dafür formuliert: bei Abklärungen, in der Kommunikation mit Angehörigen zu Pflege und Betreuung sowie bei Gesprächen zur gesundheitlichen Vorausplanung. Diese Situationen stellen hohe Anforderungen an die Gesprächsleitung, liefern jedoch wesentliche Informationen und sind für alle Beteiligten hilfreich. Unvergesslich ist mir eine Kundin, die Hindi sprach: Als mit der Dolmetscherin endlich jemand im Raum sie wirklich verstand, leuchteten ihre Augen – so lebhaft habe ich sie sonst nie erlebt.
Wie lässt sich Nähe schaffen, wenn die gemeinsame Sprache fehlt?
In Gesprächen mit Menschen mit Migrationshintergrund werden Spitex-Mitarbeitende oft als grosse Unterstützung erlebt – gelegentlich aber auch als «distanziert und zurückhaltend» beschrieben. Häufig hat das mit Unsicherheit auf beiden Seiten zu tun: Sprache und kulturelle Unterschiede erschweren den Zugang. Umso wichtiger ist eine wertschätzende, aufmerksame, respektvolle Haltung, die vermittelt: «Ihr Wohlergehen ist wichtig, wir kümmern uns um Sie und sind für Sie da.»
Hilfreich ist ein praktischer Einstieg wie ein Verbandswechsel, Medikamente zu richten oder den Blutdruck zu messen, bevor viele Fragen gestellt werden. Am besten betreuen immer dieselben Mitarbeitenden die Kundinnen und Kunden. Diese Kontinuität schafft Vertrauen und hilft dem gegenseitigen Verständnis. Eine Begrüssung in der Muttersprache bringt Nähe – und sorgt oft für ein herzliches Lächeln.
Welchen Wunsch hast du für die Patientensicherheit in Zusammenhang mit Sprachbarrieren in Zukunft?
Alle Stadtzürcherinnen und -zürcher sollen – unabhängig von Sprache und kulturellem Hintergrund – die gleiche Chance auf gute, bedarfsgerechte und einfühlsame Unterstützung haben. Dafür braucht es gut geschulte Mitarbeitende und wirksame Instrumente: interkulturelle Dolmetscherdienste, geeignete Hilfsmittel und – unter Einhaltung von hohen Datenschutzvorgaben – auch digitale Übersetzungslösungen. So gewährleisten wir Sicherheit in Behandlung und Pflege und vermitteln zugleich Vertrauen.
