Die diesjährige Aktionswoche Patientensicherheit vom 16. bis 20. September steht unter dem Motto „Diagnose. Eine Teamsache.“. Gemeint ist die Zusammenarbeit von verschiedenen Gesundheits-Institutionen wie Hausarztpraxen und Spitex-Organisationen. Diese müssen eng zusammenarbeiten, um die bestmögliche Versorgung und Patientensicherheit zu gewährleisten. Im Doppelinterview sprechen Dr. Aina Zehnder, Hausärztin in Albisrieden und Ursina Mathis, Pflegeexpertin APN bei Spitex Zürich über die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und wie sie im Alltag funktioniert.
Was passiert, wenn eine Patientin, ein Patient Spitex-Leistungen benötigt?
Aina Zehnder: Wenn ich als Ärztin erkenne, dass eine Patientin oder ein Patient Spitex-Leistungen benötigt, oder sie selbst oder ihre Angehörigen den Wunsch äussern, fülle ich die Spitex-Anmeldung aus. Die Patientin, der Patient nimmt dann Kontakt mit der Spitex auf, um einen ersten Termin für die Bedarfsabklärung zu vereinbaren. Auf Basis der ärztlichen Verordnung können sie dann die Spitex-Leistungen beziehen.
Ursina Mathis: Beim ersten Einsatz führen wir die Bedarfsabklärung durch und legen fest, welche Leistungen erforderlich sind. Diese Informationen gehen dann zurück an die Hausärztin, die die Leistungen legitimiert. Nur so werden diese auch von der Krankenkasse übernommen.
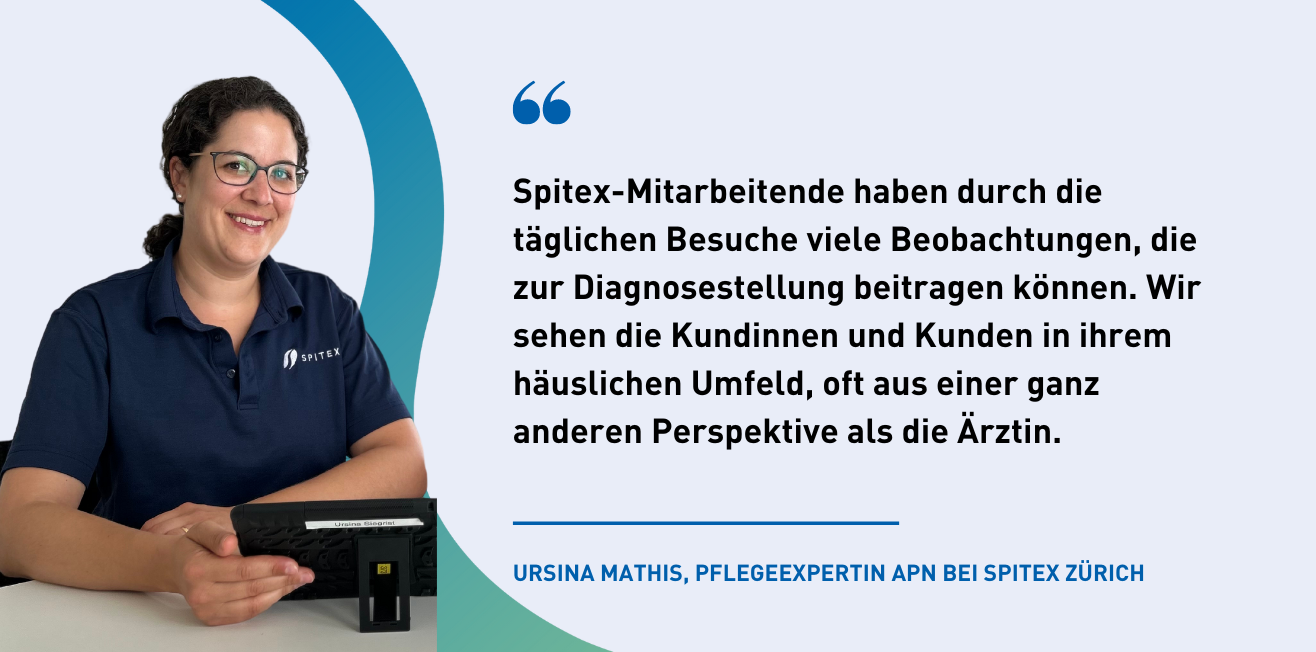
Inwiefern ist die Diagnose eine Teamsache?
Ursina Mathis: Spitex-Mitarbeitende haben durch die täglichen Besuche viele Beobachtungen, die zur Diagnosestellung beitragen können. Wir sehen die Kundinnen und Kunden in ihrem häuslichen Umfeld oft aus einer ganz anderen Perspektive als die Ärztin. Diese Beobachtungen können entscheidend sein, etwa wenn es um die geistige Verfassung oder körperliche Veränderungen geht.
Aina Zehnder: Gesundheitsversorgung ist immer eine Teamsache. Es gibt unterschiedliche Blickwinkel, die wir alle zusammenführen müssen. Ein Beispiel: Ein älterer, leicht dementer Mann zeigte Schwierigkeiten, seinen Arm zu bewegen. Dank der Beobachtungen der Spitex-Mitarbeitenden wurde er zur Hausärztin geschickt, was zu einer Diagnose eines Schlaganfalls führte. Ohne diese Zusammenarbeit hätte sich die Diagnose wahrscheinlich verzögert.
Wie arbeiten Hausarztpraxen und Spitex Zürich zusammen?
Aina Zehnder: Die Zusammenarbeit ist in der Regel kurz und einfach, besonders wenn eine präsente Fallführung seitens Spitex da ist. Bei Bedarf erfolgt die Kommunikation meist per Mail, bei komplexen Fällen telefonisch oder persönlich mit der Patientin oder dem Patienten.
Ursina Mathis: Im Normalfall ist wenig Austausch nötig. Wenn sich die Situation bei Kundinnen und Kunden jedoch schnell verändert und eine Ärztin oder ein Arzt Spitex-Leistungen anpassen muss, ist oft ein intensiverer Austausch nötig. Per Mail gelingt dies am besten.
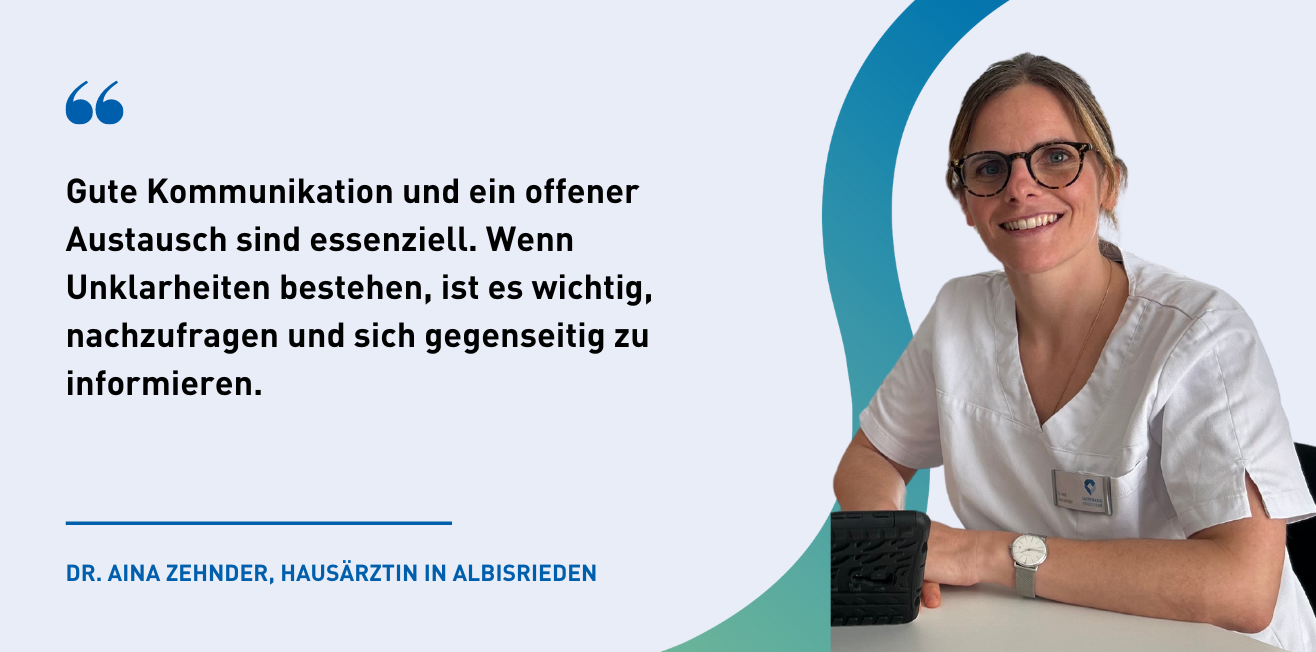
Was braucht es für eine gute Zusammenarbeit?
Aina Zehnder: Gute Kommunikation und ein offener Austausch sind essenziell. Wenn Unklarheiten bestehen, ist es wichtig, nachzufragen und sich gegenseitig über Veränderungen zu informieren. Fehler können passieren, aber durch eine konstruktiven Austausch lassen sich viele vermeiden.
Ursina Mathis: Ich stimme zu. Ein niederschwelliger Austausch ist sehr wichtig, besonders wenn auf Anfragen verlässlich geantwortet wird. Das senkt die Hürde für die Kommunikation und schafft Vertrauen. Auf Augenhöhe zu kommunizieren, ist ebenfalls entscheidend.
